Entwicklung der Eisbahnen
Geschichte der Eisaufbereitung
Herstellung der Eisfläche
Während sowohl Spritzeis als auch das Eis zugefrorener Gewässer weitestgehend von Witterungseinflüssen abhängig ist (Temperatur des Eises, überfrorener Reif, Schnee usw.), kann Kunsteis in vielfacher Hinsicht den Erfordernissen angepasst werden. Bei der Herstellung der Eisfläche wird zunächst auf den vorgekühlten Untergrund (-8 bis -10ºC) mit Schläuchen (in späterer Zeit (später Eisaufbereitungsmaschinen) eine dünne Wasserschicht aufgetragen. Das Wasser kristallisiert sofort. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt und so entsteht allmählich eine Eisschicht. Nach einiger Zeit werden die Spielfeldmarkierungen eingezeichnet und anschließend weitere Eisschichten aufgetragen. Die ideale Dicke einer Eisbahn beträgt etwa 6 bis 8 cm. Anschließend wird das Eis gehobelt und geglättet.
Die frühe Eisaufbereitung
Um einen gleichmäßigen Sportbetrieb zu gewährleisten ist es notwendig, das Eis nach Beschädigungen und gebrauchsbedingten Abnutzungen immer wieder aufzubereiten und zu glätten. Insbesondere im Eiskunstlauf und im Eishockey war die Eisbearbeitung eine große Herausforderung. Die Eisaufbereitung „von Hand“ war einen schwierige und mühselige Angelegenheit, zu der je nach Größe der zu bearbeitenden Eisfläche dutzende von Helfern notwendig waren. Vornweg ein Mann mit Hobel, dann mehrere mit Schaufeln, dahinter der „Putzlappen-Mann“. Dieser bearbeitete das Eis mit Putzlappen, die vorher in warmes Wasser getaucht worden waren. Später wurde ein Handwagen oder ein Schlitten mit einem daraufgestellten Bierfass verwendet. Aus dem Fass lief Wasser zu den hinten angebrachten Leinenlappen, die das Eis glätteten. Bei kleineren Vereinen war „Handarbeit“ noch bis in die frühen 1970er Jahre die Regel.
 |
| Eisaufbereitung anno dazumal 1 |
Die erste Eisaufbereitungsmaschine
Im Jahre 1949 baute Frank J. Zamboni eine Maschine, die diese Arbeiten allein und in einem Schritt erledigen konnte. Die Zamboni war eine Maschine, die vorne das Eis abhobelte, den Schnee über rotierende Bürsten nach oben schleuderte, wo es in einem Tank erwärmt und dann als Wasser auf den Verteilerlappen, der wie ein abgeschnittener Teppich aussieht, geleitet wird. Durch Zambonis Erfindung wurde die Eisaubereitung revolutioniert. Auch die heutigen Eisaubereitungsmaschinen arbeiten grundsätzlich noch nach dem gleichen Prinzip:
Hobeln – Waschen – Glätten
 |
| Zamboni, Modell A, 1949 (Foto: Zamboni) |
 |
| Zamboni 526, 2018 |
Die Eisbearbeitungsmaschine wurde 1949 von dem Amerikaner Frank J. Zamboni erfunden und 1953 zum Patent angemeldet. „Zamboni“ ist in mehreren Sprachen zu einem Gattungsnamen geworden. Der Begriff wird oftmals der Bezeichnung „Eisbearbeitungsmaschine“ vorgezogen. Heute gibt es weltweit ca. 1 Dutzend Firmen, die sich auf die Herstellung von Eisbearbeitungsmaschinen spezialisiert haben.
Die verschiedenen Eisarten
Beim Eishockey wird „hartes“ Eis, beim Eiskunstlauf dagegen eher“weiches“ Eis bevorzugt. Für die verschiedenen Eissportarten wird deshalb nach Möglichkeit unterschiedliches Eis präpariert.
Maßgebende Parameter für die Eisqualität sind
- die Lufttemperatur,
- die Eistemperatur,
- der Säuregehalt (PH-Wert) des Wassers und die
- Wassertemperatur bei der Eisbereitung.
PH-Wert und Wassertemperatur bei der Eisbereitung beeinflussen die Lufteinschlüsse im Wasser. Diese wiederum sind neben der Temperatur für die Eishärte entscheidend.
Bei den Eislaufsportarten und im Eishockey werden grundsätzlich ebene, von Schnee und Eispartikeln gereinigte Eisflächen verlangt, im Curling dagegen setzt man auf das „Pebbled Ice“. Bei dieser Eisart werden mit einer Art Gießkanne Wassertropfen auf die Eisfläche gesprüht, die sogleich anfrieren und eine waschbetonartige Oberflächenstruktur entstehen lassen. Dieser „Pebble“ 2 begünstigt das sogenannte „curlen“, den bogenförmigen Lauf der Curlingsteine. Für das Eisschiessen gab es zunächst kein spezielles Eis – die Eisschützen mussten sich vielmehr mit den vorgegebenen Verhältnissen zufrieden geben.
Schon bald nach Einführung von Gummilaufsohlen Anfang der 1970er Jahre zeigten sich beim Eisschießen erhebliche Schwierigkeiten. Das mittels der Eisaufbereitungsmaschine abgezogene Eis erwies sich letztlich als zu glatt. Gummilaufsohlen waren auf glattem Eis nur schwer zu spielen, da zwischen Lauffläche und Boden eine Art Vakuum entstand. Zudem wurden die Gleiteigenschaften durch triboelektrische Vorgänge (Berührungs- und Reibungselektrizität) zwischen Laufsohle und Eisfläche stark beeinflusst. Die Eisstöcke ließen sich in ihrem Lauf nicht mehr kontrollieren und kleben in der Ruhestellung wie ein Saugnapf auf dem „Spiegeleis“ fest.
 |
 |
| Spiegeleis | Eislauf und Eishockey | Pebbled-Eis | Curling |
In Burgkirchen3 stellte man mehr oder weniger zufällig fest, dass auf von Schlittschuhläufern und Eishockeyspielern zerkratztem Eis ein weitaus kontrollierbareres Eisschießen möglich war. Hier wurden auch erste Versuche im Eisschießen auf „Pebbled-Eis“ unternommen. Wegen der äußerst unterschiedlichen Gleiteigenschaften der Eisstöcke auf den verschiedenen Eisarten mussten einheitliche Regelungen geschaffen werden.
Im Jahre 1980 wurden deshalb erstmals die von der Technischen Prüfstelle Gendorf (Dipl. Ing. Dieter G. Söpper) erarbeiteten Richtlinien für die Herstellung von Eis beim Eisstocksport veröffentlicht. In diesen Richtlinien empfohlen werden das Pebbled-Eis, und das Schlittschuh-Eis.
Wie sich aber bald herausstellte war „Pebbled-Eis“ nur sehr aufwändig herzustellen 4 und zudem sehr energieintensiv. Der „Pebble“ hielt sich nur bei Eistemperaturen unter -10ºC. Aber selbst bei tiefen Temperaturen wurde der Pebble im Verlauf eines Wettbewerbes abgetragen. Durch die starken Reibungskräfte der Gummilaufsohlen wird Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt und über die Berührungsflächen von der Laufsohle an das Eis abgegeben. Als Folge dieser Energieabgabe schmilzt die oberste Eisschicht leicht an um sogleich wieder festzufrieren. Die vorhandene feine „Berg-und-Tal-Struktur“ wird quasi „glatt gebügelt“; und die Eisbahn wurde nach und nach unbespielbar. Im Jahre 1984 wurde das „Pebbled Eis“ endgültig wieder aus den Richtlinien gestrichen.
Vom Schlittschuheis zum Riefeneis
Als besonders tauglich zum Eisschiessen stellte sich von Schlittschuhläufern zerkratztes und vernarbtes Eis heraus. Da aber nicht immer von den Schlittschuhläufern eine entsprechende „Vorarbeit“ geleistet werden konnte, musste das Eis künstlich aufgeraut werden. In Burgkirchen versuchte man deshalb schon früh, die von den Schlittschuhläufern verursachten „Schäden“ am Eises mittels einer Spezialvorrichtung, an der ca. 600 Spikes angebracht waren und unter Zuhilfenahme der Eisbearbeitungsmaschine zu simulieren.
 |
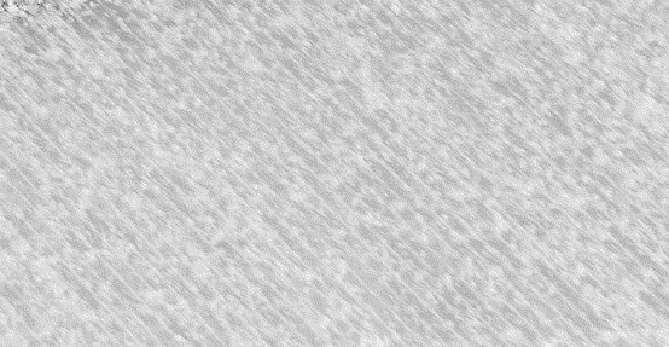 |
| Schlittschuheis | Riefeneis | Eisstocksport |
Das Ergebnis war jedoch nicht befriedigend, da hierbei nur kleine Einritzungen entstanden, die durch die abgegebene Reibungswärme (siehe Pebbled-Eis) schnell wieder geglättet wurden. Vor Allem in der stark genutzten Mitte der Spielbahn entstand so innerhalb weniger Spiele eine äußerst glatte, spiegelnde Spur. Das Laufverhalten der Stöcke innerhalb dieser Spur, die auch „Spiegel“ genannt wird, war nicht mehr kontrollierbar, mit Fortdauer des Wettbewerbes wurde die Spiegelfläche immer breiter und machte die Eisbahn zunehmend unbespielbar.
Die Gendorfer Eisschützen entwickelten daraufhin unter tatkräftiger Mithilfe von Georg Kaiser vom SV Hirten die „Gendorfer Riefenegge“ weiter und brachten sie schon Anfang der 1970er Jahre in etwa in die heutige Form.
 |
| Riefenegge Typ „Gendorf“ – Hersteller Firma Obermaier, Halsbach |
Die Riefenegge ist heute ein in der Eisaufbereitung nicht mehr wegzudenkendes Zusatzgerät, das an allen auf dem Markt befindlichen Eisbearbeitungsmaschinen angebracht werden kann. Vom Fahrersitz aus kann die Riefenegge stufenlos auf eine Riefentiefe von 1,0 bis 2,5 mm eingestellt werden. Die Riefen haben einen Abstand von 5 bis 10 mm und werden quer zur Spielrichtung in das Eis geschnitten. Riefeneis in dieser Form wird seit 1978 hergestellt und ist laut den Richtlinien für die Eisqualität beim Eisstockspiel seit 1984 für alle Meisterschaften im Eisstocksport verbindlich vorgeschrieben.
- Aus „Der Eisschieß-Sport“, von Wilhelm Neubronner, 1935 ↩
- Pebble kommt aus dem englischen und bedeutet: Kieselstein, Kiesel. ↩
- In Burgkirchen wurde zur Wintersaison 1970/71 eine Kunsteisbahn als Freianlage eröffnet. Im Jahre 1978 wurde diese Bahn überdacht und in „Keltenhalle“ umbenannt. Nach der Wintersaison 2009/10 wurde die Halle, zwischenzeitlich von der Gemeinde Burgkirchen betrieben, aus finanziellen Gründen geschlossen. ↩
- IFE-Prüfstellenleiter Dieter Söpper spritze die Wassertropen eigenhändig mittels eine Rückenspritze auf die Eisbahn. ↩